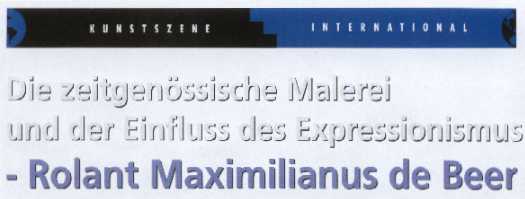|
Rolant Maximilianus de Beers Werke wirken intensiv auf die Psyche des Betrachters. Der Ausstrahlung der
Malerei, die ihre Wurzeln im Expressionismus hat, kann man sich kaum entziehen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich das Lager der Kunstfreunde, die sich mit seiner Kunst auseinandersetzen, rasch
in zwei Gruppen spaltet: in vorbehaltlose Bewunderer und extreme Kritiker.
 |
Die Malerei des Niederländers bezieht Position und lässt wenig Spielraum für Zwischentöne. Vor allem dann wenn er mit seinen Bildern Themen aufgreift, die den
Tod behandeln, allen voran Zyklen zum Thema „AIDS“, die er bereits mehrfach im Münchner, Berliner und Amsterdamer Raum ausgestellt hat. Aber auch bei Arbeiten, die keine so emotional
beladenen Titel tragen, fordert de Beer von seinem Publikum eine engagierte Haltung ab. Bei den überdimensionalen Kopfbildern zum Beispiel, die einen wesentlichen Bestandteilen seines Werkes
ausmachen. Sie sind durch den holzschnittartigen Duktus dermaßen psychologisch aufgeladen, dass man spürt, wie sehr es dem Maler darum ging, den inneren Charakter des Dargestellten
herauszuarbeiten.Der monochrome
Hintergrund ist auf die Gesamtwirkung abgestimmt. Die Farben demonstrieren den Augenausdruck, der hier bewusst betont wurde. Augen, die den Betrachter
unverwandt ins Gesicht schauen und ihn so selbst zum Betrachter „degradiert“. |
|
Betitelt wurden diese Köpfe von Rolant Maximilianus de Beer meistens mit „Gesicht“. Ein gefährlicher
Titel, denn bei einem Gesicht sucht man nach Ähnlichkeiten zwischen dem Bild und einem imaginären Konterfeiten, den es jedoch bei de Beer im eigentlichen Sinne nicht gibt. Bei den „Gesichtern de Beers
handelt es sich häufig um Überblendungen mehrerer Eindrücke. Um Menschen, denen der Künstler zufällig begegnet ist, oder Menschen, die ihn intensiv beschäftigen. Diese Eindrücke formt der Maler zu einem
„Portrait“.
De Beer ist kein „Schönmaler“. Mit Stilmitteln expressionistischer Provenienz formt er „Kopflandschaften“, denen man in dieser Form vor allem in der Kunst der
sogenannten Primitiven begegnet. Wie Emil Nolde sah auch de Beer hier eine Kraftquelle, welche die Kunst der Moderne zu nutzen verstehen sollte.
Auch für den 1952 in den Niederlanden geborenen Künstler waren mehrere
Südseereisen Initiationserlebnisse bezüglich seiner Malerei. In Neuseeland entdeckte er die Kunst der Maori und studierte deren Formenkanon. Auch von den Farben der
Südseereisen ließ er sich inspirieren. In den Niederlanden, so bekennt de Beer heute freimütig, kam sein Stil überhaupt nicht an, weil dort die expressionistische Tradition
gar nicht vorhanden sei. Das Publikum in Deutschland sei durch den „Blauen Reiter“, durch die „Dresdner Brücke“ und nicht zuletzt durch Emil Nolde bezüglich des
Expressionismus vorgeprägt. Hierin sieht er die Hauptursache, warum er mit seinen Arbeiten in Deutschland, wo er seit 1988 lebt, einen solchen Erfolg hat.
|